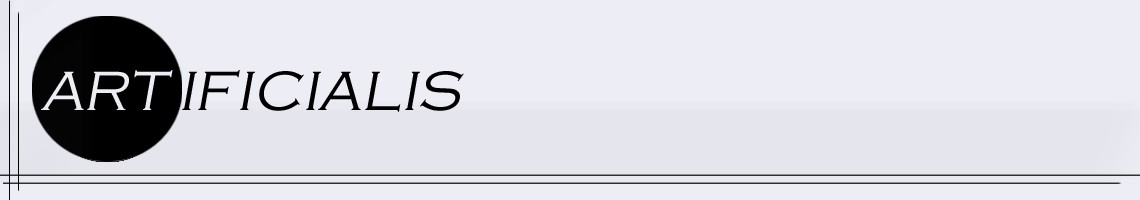Jürgen Waller „Die Leute wollen da gar nicht dran erinnert werden.”
Republished interview from July 2010
 Jürgen Waller, Maler, Keramiker und Objektmacher hat 1978 im Bremer Stadtteil Gröpelingen mit Studierenden der Bremer Hochschule für Künste drei Außenwände des Bunkers Pastorenweg gestaltet. Das Thema ist die Geschichte des Stadtteils Gröpelingen und der Werft AG-Weser von 1878 bis 1978. Im Juli 2010 hatte ich Gelegenheit mit ihm über dieses Historienbild im öffentlichen Raum zu sprechen. Wir trafen uns in einem Café in Vallauris (Südfrankreich), wo er seinen Zweitwohnsitz hat.
Jürgen Waller, Maler, Keramiker und Objektmacher hat 1978 im Bremer Stadtteil Gröpelingen mit Studierenden der Bremer Hochschule für Künste drei Außenwände des Bunkers Pastorenweg gestaltet. Das Thema ist die Geschichte des Stadtteils Gröpelingen und der Werft AG-Weser von 1878 bis 1978. Im Juli 2010 hatte ich Gelegenheit mit ihm über dieses Historienbild im öffentlichen Raum zu sprechen. Wir trafen uns in einem Café in Vallauris (Südfrankreich), wo er seinen Zweitwohnsitz hat.
 Astrid Gallinat: Als Du 1977 an die Bremer Hochschule für Künste kamst, gab es das Programm „Kunst im öffentlichen Raum” bereits seit vier Jahren in Bremen. Wie hatte sich die Kunst im öffentlichen Raum bis dahin entwickelt? Was war da passiert?
Astrid Gallinat: Als Du 1977 an die Bremer Hochschule für Künste kamst, gab es das Programm „Kunst im öffentlichen Raum” bereits seit vier Jahren in Bremen. Wie hatte sich die Kunst im öffentlichen Raum bis dahin entwickelt? Was war da passiert?
Jürgen Waller: Ursprünglich haben die Verbände dafür gekämpft. 73 war der Durchbruch mit der berühmten 2%-Kunst-am-Bau-Klausel und deren Umsetzung. Jedoch richteten sich diese 2 % an Neubauten.
Bremen hatte im Gegensatz zu vielen anderen Städten – weil es auf Sand gebaut war oder ist – kaum Tiefbunker, sondern die Hochbunker. Das sind ja riesige Betonwände. Und Bremen hat dann ein Model entwickelt, dass mit dem Geld dieser 2 % Künstler diese Bunker verschönerten.
Das erste Projekt war für irrsinnig viel Geld die Gestaltung des Bunkers Hardenbergstraße. Dieser Bunker wurde dann mit einer Ähre bemalt. Der Künstler kriegte dafür glaube ich 80 oder 90.000 Mark, also es war irrsinnig viel Geld …
 Dann war es, meiner Kenntnis nach oder meiner Erinnerung nach, das erste sagen wir etwas politische Bild von Hermann Stuzmann mit dem Brief „Liebe Herta! …” also, dass es wie ein Notizblock aussah. Es gab dann furchtbar viele Widerstände und diese ursprüngliche Fassade wurde nicht bemalt, sondern musste ausweichen auf einen anderen Bunker. Dann gab es auch keine Diskussion mehr.
Dann war es, meiner Kenntnis nach oder meiner Erinnerung nach, das erste sagen wir etwas politische Bild von Hermann Stuzmann mit dem Brief „Liebe Herta! …” also, dass es wie ein Notizblock aussah. Es gab dann furchtbar viele Widerstände und diese ursprüngliche Fassade wurde nicht bemalt, sondern musste ausweichen auf einen anderen Bunker. Dann gab es auch keine Diskussion mehr.
Am Anfang waren die Leute unheimlich dagegen. Aber als es dann fertig war, kam das Fernsehen von überall her, auch die BBC London, und dann fanden sie das auf einmal ganz gut. Da war Öffentlichkeit hergestellt und es wurde dann zu einer Art Pilgerstätte. Im vorletzten Jahr, also nach 30 Jahren, habe ich das Ding restauriert, weil die Stadt es verkommen ließ. Ich musste die fast verklagen. Aber jetzt steht es mittlerweile unter Denkmalschutz.
J.W.: Ja, das war die Folge dieses Wandbildes. Es war damals so, dass auch die Politik solche Forderungen stellte und merkte, dass man Bunker nicht einfach wegstreichen kann, sondern dass ein Bunker einen bestimmten Sinn und Zweck erfüllt, auf den man hinweisen sollte.
A.G.: Kann man das auch irgendwie in Zusammenhang mit dem deutschen Herbst (1977) sehen? Ich hatte mal daran gedacht, weil die Stimmung da noch politischer wurde …
J.W.: Naja, es gibt ja immer relativ wenig Künstler, die politisch sind. Wenn, dann schwimmt man mal mit. Hier in Frankreich gab es auch so eine Bewegung nach 68. Das Problem ist aber die Umsetzung. Zu einem politischen Bild zu kommen ist sehr schwer. Und den meisten fällt nichts anderes ein, als irgendwelche Parolen abzumalen. Ich sag immer „Die malen die rote Faust” und das bringt uns aber nicht weiter.
Wir haben auch keine Tradition. Die Tradition ist eigentlich die mexikanische Wandmalerei, die aber auch eine ganz spezielle ist. Ich hab Siqueiros [David Alfaro] kennengelernt. Das war eine Kunst, die eine politische Manifestation war, sich aber an Analphabeten richtete, weil die waren damals Analphabeten, die konnten also nur Bilder sehen. Daher ist die Kunst natürlich auch auf unsere Breitengrade sehr schwer anzuwenden. Wer so was noch konnte, war Guttuso [Renato], der auch keine Wandbilder gemalt hat, aber riesen Tafelbilder. Er hat sich eben auch explizit mit dem Mai 68 beschäftigt. Das sind aber so schon diese Traditionen. Ich kannte zum Beispiel Julio Leparque, ein kinetischer Künstler der aber in Paris mit der Maschinenpistole im Auto Revolution anzünden wollte, sagte aber „Kunst und Politik: hat beides nichts miteinander zu tun”.
A.G.: Nochmal zum Thema Vorbilder und Inspirationen: das Gröpelinger Bunkerbild ist natürlich politische Kunst, aber es ist gleichzeitig auch ein Historienbild …
J.W.: Das ist richtig! Das ist ja auch dann Meins. Ich ja hab dann zurückgegriffen auf Signifikanzen, wie das Bild von Otto Dix, aus dem ersten Weltkrieg.
In Bremen in der AG-Weser wurden, die im Harz vorgefertigten U-Boote zusammen gebaut. Man baute dann ja nicht unweit davon, an der Weser, diesen U-Boot-Bunker Valentin. Da sollten am Tag zwei bis 3.000 U-Boote zusammen gesetzt werden, die alle mit dem Schiff aus dem Harz kamen. Die Einzelteile wurden dort unterirdisch hergestellt, da man die U-Boote mit der Eisenbahn nicht in Gänze transportieren konnte. Die Züge rollten auch nur nachts, ohne Licht. Damals gab es noch nicht die modernen Ortungsgeräte. Hat nur Gott sei Dank alles nicht mehr funktioniert.
A.G.: Und die Initiative für das Wandbild ganz speziell war eigentlich schon vorhanden, an der Kunsthochschule …
J.W.: … und ich habe das dann in Form gebracht.
 A.G.: Aber die Idee, dass es die Werft sein sollte, war die auch schon da?
A.G.: Aber die Idee, dass es die Werft sein sollte, war die auch schon da?
 Nur ich hatte damals diese Idee. Es gab keine Brüche, und da es keine Brüche gab, habe ich mir gedacht, dann muss das auch so fließend gemalt sein. Deshalb habe ich dann die beiden Winkel an den Seiten ausgenutzt. Einmal ist die Ecke ein Schiffsrumpf. Wenn man davor steht, sieht das so aus, als käme da so ein Schiff raus. Und bei dem anderen Winkel war es, glaube ich, ein Öl-Förderturm oder wie auch immer. Und wie gesagt, es sollte fließend sein. Das war zumindest meine Vorstellung damals, von dem wie man es machen könnte. Ich hätte gerne gehabt, dass man das selbe Motiv, den selben Ablauf in drei verschiedenen Versionen malt. Aber das ist natürlich immer so eine Sache, erstmal gibt es den selben Bunker nicht nochmal.
Nur ich hatte damals diese Idee. Es gab keine Brüche, und da es keine Brüche gab, habe ich mir gedacht, dann muss das auch so fließend gemalt sein. Deshalb habe ich dann die beiden Winkel an den Seiten ausgenutzt. Einmal ist die Ecke ein Schiffsrumpf. Wenn man davor steht, sieht das so aus, als käme da so ein Schiff raus. Und bei dem anderen Winkel war es, glaube ich, ein Öl-Förderturm oder wie auch immer. Und wie gesagt, es sollte fließend sein. Das war zumindest meine Vorstellung damals, von dem wie man es machen könnte. Ich hätte gerne gehabt, dass man das selbe Motiv, den selben Ablauf in drei verschiedenen Versionen malt. Aber das ist natürlich immer so eine Sache, erstmal gibt es den selben Bunker nicht nochmal.
Hinzu kam, ich habe erstmal ein halbes Jahr da verbracht, das reichte mir schon, und mit so einem Haufen wild diskutierender Studenten. Ich hatte auch Studenten, die haben gemalt was ich ihnen gesagt habe, und andere, die meinten, sie müssten jeden Handstrich mit mir diskutieren, naja …
 J.W.: Ja, das Problem war da. Ich habe meinen Studenten erstmal beigebracht, dass sie morgens um 7 Uhr anfangen müssen. Ich kannte das aus anderen Stadtteilen: ach der Künstler kam mal gar nicht, dann kam er nachmittags um zwei, dann ist er um halb drei schon wieder gegangen. Ich hab gesagt: „So was gibt es bei uns nicht! Das ganze Ding wird wie ein vernünftiger Arbeitstag, inklusive Samstag.” Da war ich meistens alleine da, weil ich dann das alles korrigieren musste, was die alles so gemalt hatten; wie gesagt, das Problem ist bei solchenProjekten, dass immer die schlechtesten reingehen, was ich nicht verstecken kann.
J.W.: Ja, das Problem war da. Ich habe meinen Studenten erstmal beigebracht, dass sie morgens um 7 Uhr anfangen müssen. Ich kannte das aus anderen Stadtteilen: ach der Künstler kam mal gar nicht, dann kam er nachmittags um zwei, dann ist er um halb drei schon wieder gegangen. Ich hab gesagt: „So was gibt es bei uns nicht! Das ganze Ding wird wie ein vernünftiger Arbeitstag, inklusive Samstag.” Da war ich meistens alleine da, weil ich dann das alles korrigieren musste, was die alles so gemalt hatten; wie gesagt, das Problem ist bei solchenProjekten, dass immer die schlechtesten reingehen, was ich nicht verstecken kann.A.G.: In dem Bild sind auch Bürger von Gröpelingen dargestellt. War das von Anfang an so geplant? Ich habe es zumindest gelesen, dass da Anwohner drauf sind …
J.W.: Nein! Die abgebildeten realen Personen, das waren Widerstandskämpfer. Ich habe zum Beispiel Carl von Ossietzky reingebracht, nicht weil der sich in Gröpelingen betätigt hatte, er war irgendwo ganz anders. Aber er war ein Synonym für Widerstand. Außerdem gab es zur gleichen Zeit in Oldenburg eine Diskussion: die wollten nämlich ihre Universität Carl von Ossietzky – Universität nennen. Das wurde vom Wissenschaftsministerium Niedersachsen erstmal und dann von der Stadt abgelehnt. Sie haben es dann hinterher durch gekriegt. Nicht zuletzt auch durch viel Unterstützung einer, ich sag jetzt mal, linksgerichteten Bevölkerungsschicht.
Auch waren eben die Leute drauf, die ich selbst kennengelernt habe. Menschen, die im aktiven Widerstand waren, die im KZ waren, die aber Gott sei Dank überlebt hatten. Sie sind auch als wieder erkennbare Figuren dargestellt, damit der Widerstand wieder aus der Anonymität, wieder aus der Beschreibung raus geholt wird, um zu zeigen: „Die da waren dabei!”
A.G.: Also war es nicht so, wie ich bei dem Text den Eindruck hatte, dass es Leute waren, die immer noch in Gröpelingen wohnten?
J.W.: Nein.
Es waren aber historische Personen?
J.W.: Ja.
A.G.: Und wie waren die Reaktionen darauf, das wirklich echte Widerstandskämpfer porträtiert wurden?
J.W.: Die Leute haben ja gar nichts kapiert, das war das Drama. Das interessierte die auch gar nicht, die hatten ihre Postkarten und die Postkarten zeigten eben wirklich die alte Mühle und die sagten dann „Mit meinen Eltern haben wir da immer Kaffee getrunken”. Das waren so deren Geschichten. Es liegt doch in der Natur der Dinge. Die Leute verdrängen diese Scheiß-Geschichte, die wollen da gar nicht dran erinnert werden. Das haben wir auch oft genug zu hören gekriegt. Und wie gesagt, erst als dann BBC-London da stand und die den Bunker untersucht haben, da haben die erstmal richtig hingeguckt. Vorher haben sie nur gesehen, da ist nicht die alte Straßenbahn drauf. Und jetzt, nach 25 Jahren, da war die Reaktion natürlich ganz anders. Da fanden sie das Bild ganz toll. Auch weil, ich will nicht direkt sagen ein Wallfahrtsort, aber es ist sehr oft besucht. Wenn Gruppen kommen, die etwas über Bremen erfahren wollen, werden die an dieses Wandbild geführt. Und dadurch sehen die Leute natürlich, dass es auch in irgendeiner Form eine Bedeutung hat und so haben sie langsam angefangen es zu akzeptieren.
 A.G.: Und als Du das Wandbild restauriert hast, da hast Du wieder mal unter der „Aufsicht” der Anwohner gearbeitet. Wie war da die Reaktion?
A.G.: Und als Du das Wandbild restauriert hast, da hast Du wieder mal unter der „Aufsicht” der Anwohner gearbeitet. Wie war da die Reaktion?
J.W.: Positiv. Das Ding war ziemlich runtergekommen, und zwar weil man einfach die Dachrinnen nicht gepflegt hat. Es hieß immer: „Ja, wir haben kein Geld!” Außerdem muss man dazu sagen, das es damals als ephemere Kunst angelegt war. Es war nicht abzusehen, dass sich dann so zwei drei heraus entwickelten, die eine historische, und nicht nur historisch, sondern auch eine funktionelle Bedeutung haben. Ich habe später dieses eine „Gegner und Opfer des Faschismus” gemalt. Das ist 24 Meter breit und 25 Meter hoch, das ist natürlich ein ganz anderes Bild. Das eine steht und das andere kommt jetzt unter Denkmalschutz. Auch das muss im Herbst restauriert werden. Im letzten Jahr sind aus dem Beton Steine auf Autos gefallen.
Daraufhin bekam der Kultursenator Druck vom Innensenator, dem diese ganzen Bunker unterstehen. Daher haben sich die Leute, als ihr Auto kaputt war oder eine Beule hatte, an den Innensenator gewandt und der hat sich dann sofort an den Kultursenator gewandt „Ihr müsst renovieren”.
Also man hat damit gar nicht gerechnet, dass die Bilder langfristig bleiben werden. Die Dinger sollten eigentlich nach drei, vier, fünf Jahren wieder überstrichen werden.
A.G.: Die dargestellte Geschichte von Gröpelingen endet mit dem Fries 1978, kurz bevor die Werft zumacht, in der damaligen Jetzt-Zeit. Du sagtest eben selbst, die Schließung ist schon angedeutet, daher war das damals hochaktuell. Wie aktuell ist es heute noch, für den Stadtteil?
J.W.: Gar nicht! Der Stadtteil hat sich total gewandelt.
Die Bevölkerungsstruktur hat sich insofern stark gewandelt, dass eine Mehrheit türkische Migranten ist. Viele der Werftarbeiter von damals haben sich selbstständig gemacht. Es gab Leute, die drehten die Form für die Schiffsschrauben, die haben gesagt, „OK Schiffsschrauben brauchen wir immer, wir sind drei Leute, wir versuchen es einfach!” Sie haben sich selbstständig gemacht und kriegten Aufträge. Es gibt also nach wie vor sehr viel Schiffsbau, aber im Detail. Dann gibt es, da wo die AG-Weser früher war, ein riesen Einkaufszentrum. „Waterfront” nennt sich das, weil es halt am Wasser ist. Der Stadtteil hat sich gewandelt, hat aber nach wie vor eine große Arbeitslosigkeit.
A.G.: Müsste man die Geschichte vielleicht jetzt weiterschreiben? Auf dem Bunker sind ja 100 Jahre Geschichte zu sehen, könnte man da nicht die nächsten 30 Jahre bildnerisch umsetzen?
J.W.: Sie ist ja nicht mehr so signifikant wie eine solch große Werft, in der fast jeder Bewohner Gröpelingens gearbeitet hat, oder aus jeder Familie ein Mensch, ein Mitglied einer Familie bei AG-Weser gearbeitet hat. Das gibt es ja nicht mehr. Es gibt kleine Geschäfte, es gibt so kleine Zwei-Mann-, Drei-Mann-Betriebe. Was soll man daraus machen? Es ist nichts aufregendes mehr passiert.
 J.W.: Nein, die kamen ja beide später. Erstmal, das Ding von Altenstein ist grausam, eigentlich müsste man das eingießen. Waldemar Otto hat da so seinen Clown, mit einer Aktentasche, wo früher die Butterbrote drin waren. Die stehen auch an Plätzen, die mit der AG-Weser nichts zu tun haben.
J.W.: Nein, die kamen ja beide später. Erstmal, das Ding von Altenstein ist grausam, eigentlich müsste man das eingießen. Waldemar Otto hat da so seinen Clown, mit einer Aktentasche, wo früher die Butterbrote drin waren. Die stehen auch an Plätzen, die mit der AG-Weser nichts zu tun haben. A.G.: Jetzt nochmal etwas ganz allgemeines: Du hast ja vor 68 und bis 78 auch schon politische Kunst gemacht, von daher ist es nicht ganz überraschend gewesen, das Du an so einem Bild gearbeitet hast. Aber es waren Tafelbilder. Gibt es trotzdem in Deinem Werk eine Linie?
J.W.: Natürlich gibt es eine Linie!
 Nein, das Problem ist einfach, ich habe bis 68 hier [in Vallauris] und in Paris oder in Varreddes gearbeitet und bin dann eben 68 nach Berlin gegangen. Und da ist dann schon ein Bruch, weil in Westberlin kriegte man das ja Hautnah mit. Wenn ich meine Bilder ausstellen wollte, bekam ich gesagt „Dann geh doch nach drüben!” Die Reaktionen waren ganz anders. Hier gab es eine starke KP, das war hier kein Schimpf und Schande, bei uns ja.
Nein, das Problem ist einfach, ich habe bis 68 hier [in Vallauris] und in Paris oder in Varreddes gearbeitet und bin dann eben 68 nach Berlin gegangen. Und da ist dann schon ein Bruch, weil in Westberlin kriegte man das ja Hautnah mit. Wenn ich meine Bilder ausstellen wollte, bekam ich gesagt „Dann geh doch nach drüben!” Die Reaktionen waren ganz anders. Hier gab es eine starke KP, das war hier kein Schimpf und Schande, bei uns ja.
 Dann, nach drei Tagen, bekam ich einen Anruf, dass sie den Neckermann abhängen müssten, weil die Jüdische Gemeinde, Herr Galinski an vorderster Front, hätte in dem Bild antisemitische Züge erkannt. Ich hatte nun aber das Glück, dass einer der wichtigsten deutschen Kritiker damals, Heinz Ohff, mir das Vorwort für den Katalog geschrieben hat. So habe ich dann auch gleich eine einstweilige Verfügung bewirkt. Das ging hin und her. Auch da war es wieder so, dass das Bild im Keller war, aber wenn die Presse kam, wurde es wieder aufgehängt, damit man sehen konnte, was es für ein schlimmes Bild ist. So schoss sich die Presse auf einmal auf das Bild ein, aber positiv. In dem Zusammenhang gab es eine große Versammlung und da hieß es auch, solche Bilder wollen wir hier nicht sehen, die können sie da drüben ausstellen. Ich sagte: „Da drüben wollen die die auch nicht.” [Lacht herzlich]
Dann, nach drei Tagen, bekam ich einen Anruf, dass sie den Neckermann abhängen müssten, weil die Jüdische Gemeinde, Herr Galinski an vorderster Front, hätte in dem Bild antisemitische Züge erkannt. Ich hatte nun aber das Glück, dass einer der wichtigsten deutschen Kritiker damals, Heinz Ohff, mir das Vorwort für den Katalog geschrieben hat. So habe ich dann auch gleich eine einstweilige Verfügung bewirkt. Das ging hin und her. Auch da war es wieder so, dass das Bild im Keller war, aber wenn die Presse kam, wurde es wieder aufgehängt, damit man sehen konnte, was es für ein schlimmes Bild ist. So schoss sich die Presse auf einmal auf das Bild ein, aber positiv. In dem Zusammenhang gab es eine große Versammlung und da hieß es auch, solche Bilder wollen wir hier nicht sehen, die können sie da drüben ausstellen. Ich sagte: „Da drüben wollen die die auch nicht.” [Lacht herzlich] Nein, wie gesagt, zwischen Paris und West-Berlin war schon eine ganz andere Situation.
A.G.: Wie Du sagst hast Du Deinen Briefträger porträtiert, der Antifaschist war, dann ist das ein Motiv, dass auch in Gröpelingen wieder auftaucht.
J.W.: Jaja!
A.G.: Das ist irgendwie nicht ganz überraschend, kann man sagen. Das ist schon irgendwie eine Linie?
J.W.: Ja! Hier waren die Bilder alle sehr blockhaft, Einzelfiguren, aber das waren auch mehr Stereotypen. Und das hat sich in Berlin total geändert.
A.G.: Man könnte also abschließend feststellen, dass es bei Dir eine Entwicklung von sozial-politisch motivierter Malerei vor 1968 in Frankreich, über politische Tafelbilder ab 1968 in Berlin, hin zur ersten Historien-Wandmalerei seit dem 2. Weltkrieg im ehemaligen Westdeutschland gab. Da scheint es auch kein Zufall zu sein, dass sich gerade dieses Gemälde im öffentlich Raum, genauer auf der Straße auf einem Bunker und nicht in irgendeinem Verwaltungsbau befindet, oder?
 J.W.: Meine ersten politischen Bilder sind 1961 in Frankreich gegen den Algerienkrieg entstanden. Das war so: mein erster Schwiegervater war ein hoher Funktionär in der KP. Der nahm mich mit, um Plakate gegen den Algerienkrieg zu kleben. Ich war damals ein-, zweiundzwanzig und für mich als Deutschen waren die Kriege damals vorbei. Hier kam ich dann in die Situation, dass Frankreich zwar Krieg führte, aber auch irgendwo ganz woanders, und dass es Leute gab, die sich gegen den Krieg gewehrt haben. Ich war zwar schon vorher politisiert, aber das hat dann nochmal so einen Kick gegeben, sich intensiv mit Kolonialismus zu beschäftigen. In Deutschland gab es das nur in extrem kleinem Maße. Wir haben ja keinen Krieg mehr gehabt, wir waren ja glücklich mit dem Wiederaufbau, wir hatten die ersten Jahre unseres sogenannten „Wirtschaftswunders”, wir konnten wieder reisen. Ich kam nach Frankreich und hörte in jedem dritten Satz „Sale Bosch”. Ich hab dann gesagt „Ich kann da leider nichts dazu”. Dann habe ich angefangen zu diskutieren, dass ich leider, nein, dass ich Gott sei Dank nichts dazu kann. Ich kannte noch nicht das Wort, dass hat ja Kohl geprägt, „die Gnade der späten Geburt”. Ich hätte denen das so um die Ohren gehauen, ich hatte damit nichts zu tun. Was mein Vater gemacht hat, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat, aber was die erlebt haben, ich weiß es nicht. Was die gesehen haben, was sie nicht erzählen durften, weiß ich auch nicht. Aber ich konnte versuchen, diese Geschichte auf dem Bunker zu erzählen, dort, wo es jeder sehen kann.
J.W.: Meine ersten politischen Bilder sind 1961 in Frankreich gegen den Algerienkrieg entstanden. Das war so: mein erster Schwiegervater war ein hoher Funktionär in der KP. Der nahm mich mit, um Plakate gegen den Algerienkrieg zu kleben. Ich war damals ein-, zweiundzwanzig und für mich als Deutschen waren die Kriege damals vorbei. Hier kam ich dann in die Situation, dass Frankreich zwar Krieg führte, aber auch irgendwo ganz woanders, und dass es Leute gab, die sich gegen den Krieg gewehrt haben. Ich war zwar schon vorher politisiert, aber das hat dann nochmal so einen Kick gegeben, sich intensiv mit Kolonialismus zu beschäftigen. In Deutschland gab es das nur in extrem kleinem Maße. Wir haben ja keinen Krieg mehr gehabt, wir waren ja glücklich mit dem Wiederaufbau, wir hatten die ersten Jahre unseres sogenannten „Wirtschaftswunders”, wir konnten wieder reisen. Ich kam nach Frankreich und hörte in jedem dritten Satz „Sale Bosch”. Ich hab dann gesagt „Ich kann da leider nichts dazu”. Dann habe ich angefangen zu diskutieren, dass ich leider, nein, dass ich Gott sei Dank nichts dazu kann. Ich kannte noch nicht das Wort, dass hat ja Kohl geprägt, „die Gnade der späten Geburt”. Ich hätte denen das so um die Ohren gehauen, ich hatte damit nichts zu tun. Was mein Vater gemacht hat, da kann ich nichts zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemanden umgebracht hat, aber was die erlebt haben, ich weiß es nicht. Was die gesehen haben, was sie nicht erzählen durften, weiß ich auch nicht. Aber ich konnte versuchen, diese Geschichte auf dem Bunker zu erzählen, dort, wo es jeder sehen kann.